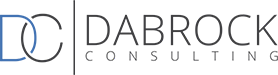In der Palliativversorgung geht es um die Würde des Menschen – Neues Gesetz schafft einen Rahmen
Endlich. Wenn der Deutsche Bundestag in dieser Woche über das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland (HPG) und insbesondere über die flächendeckende spezialisierte ambulante Palliativversorgung abstimmt, geht es auf der einen Seite um ein Gesetz, dass für viele Menschen in der letzten Lebensphase eine bessere ärztliche und pflegerische Versorgung bringen wird. Das ist gut so und überfällig.
Es geht aber auch um die Beantwortung der Frage, wie wir als deutsche Gesellschaft Menschen in ihrer Lebensphase begleiten möchten, wie wir selbst sterben möchten und was uns das als Gesellschaft wert ist. Jede Leistung durch Ärzte, Pflegende und Begleiter hat einen materiellen Gegenwert, sie kostet Geld.
Vielleicht ist das das Wichtigste an dem jetzt durch den Bundestag zu verabschiedenden Gesetzentwurf, dass dieser die Frage beantwortet, dass Menschen, bei denen keine Heilung ihrer Erkrankung mehr möglich ist und die in der letzten Lebensphase stehen, ein Anrecht darauf bekommen, nach allen Regeln der heutigen ärztlichen und pflegerischen Möglichkeiten Linderung ihrer Leiden – auch damit ist Krankheit verbunden – und Begleitung zu erfahren. Und zwar dort, wo sie gerne leben möchten. Das ist für die meisten Menschen – und dieser Wert ist seit vielen Jahren in allen Befragungen relativ stabil – die gewohnte häusliche Umgebung. Wo auch immer diese ist und wie auch immer diese aussieht. Da sind Menschen und ihre Bedürfnisse sehr verschieden. Aber die wenigsten Menschen wünschen sich, im Krankenhaus – und dort nicht auf der Palliativstation – zu versterben, obwohl es mit leichten prozentualen Unterschieden zwischen den deutschen Bundesländern – je nach Versorgungsstruktur – viele von ihnen tun (müssen). Nichts gegen Krankenhäuser und gegen die dort tätigen in der Regel sehr engagierten Ärzte und Pflegekräfte. Aber deren Fokus ist in der Regel ein anderer.
Der eigentliche Skandal – der jetzt durch das Gesetz behoben werden soll – ist, dass es zwar seit vielen Jahren mit viel Engagement aufgebaute Hospize und Palliativstationen gibt, die wie Leuchttürme den Weg weisen auch für andere „Marktteilnehmer“ für das was möglich ist: Menschen in der letzten Phase begleiten, ihnen eine optimale Schmerzbehandlung zukommen zu lassen und sie gut zu pflegen. Aber von diesem Engagement kommt in der sogenannten Regelversorgung immer noch wenig an. Insbesondere im ambulanten Bereich.
Das kostet Engagement, dass viele Ärzte und Pflegekräfte seit Jahren einbringen – und es kostet Geld. Viel Geld. Und da werden die Diskussionen im deutschen Gesundheitswesen schwierig. Willkommen im föderalen System. Das hat zur Folge, dass die meisten ambulanten und stationären Hospize seit jeher chronisch unterfinanziert und auf Spenden angewiesen sind. Vielen Palliativstationen in Krankenhäusern – selbst wenn diese in den jeweiligen Landeskrankenhausplänen als solche ausgewiesen sind – geht es auch nicht besser. Ähnliches gilt für die Vergütung der ambulanten palliativen Versorgung. Jetzt könnte man argumentieren, es könne nicht Aufgabe der Gesellschaft durch die gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung sein, flächendeckende palliative Versorgungsstrukturen vorzuhalten.
Genau das ist es aber. Nach deutschem Rechtsverständnis ist die Würde des Menschen unantastbar. Insbesondere dort, wo es um Menschen geht, die durch Krankheit, Alter oder Behinderungen in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind, geht es immer auch um Würde. Würde erfahren die Betroffenen auch dadurch, dass ihnen die Gesellschaft auch Wertschätzung dahingehend entgegenbringt, dass sie ihnen die bestmöglichen medizinischen Möglichkeiten der Palliativmedizin zur Verfügung stellt. Alles andere wäre eine Rationierung medizinischer und pflegerischer Leistungen und hat mit Würde wenig zu tun. Nebenbei bemerkt: es geht hier nicht um Maximaltherapie um jeden Preis bis zum Lebensende ohne Aussicht auf Heilung. Es geht um Linderung von Leiden und insbesondere von Schmerzen in einer Lebenssituation, wenn keine Heilung mehr möglich ist. Damit geht es um Lebensqualität für die Betroffenen und für deren Angehörige.
Insbesondere im ambulanten Bereich bleibt hier viel zu tun. Das fängt bereits in der Medizinerausbildung im Studium an, wo Palliativmedizin bisher kaum eine Rolle spielt – das Bewusstsein wird früh geprägt. Wenn jetzt mehr Mittel für diesen Bereich zur Verfügung gestellt werden, werden die Leistungen folgen. Das ist gut für die Patienten und für die Angehörigen. Gleichwohl wird es weiter die „Leuchttürme“ der stationären Hospize und Palliativstationen geben müssen, die einerseits die fachliche Entwicklung der Palliativmedizin vorantreiben, andererseits sich um die Betroffenen kümmern, die nicht in ambulanten Strukturen angemessen versorgt werden können. Dass die Regelversorgung in der Palliativmedizin jetzt weiter ausgebaut werden soll, ist ein überfälliger Schritt in die richtige Richtung.
Im Johannes-Hospiz der Barmherzigen Brüder in München-Nymphenburg – ein großer „Leuchtturm“ in der deutschen Hospizlandschaft – hing vor einigen Jahren ein handgeschriebener Zettel an einer Pinwand links hinter dem Eingang, eine Abwandlung eines Zitates von Theodor W. Adorno: „Wenn das, was ist, sich ändern läßt, ist das was ist, nicht alles.“
Der Gesetzgeber schafft mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland (HPG)“ einen Rahmen. Kostenträger und Anbieter werden sich an der Umsetzung messen lassen müssen. Weil es um mehr geht als um medizinische Leistungen – es geht zunächst und ganz entscheidend um Menschenwürde. Und wenn sich hier Einstellungen ändern, werden Menschen in ihrer letzten Lebensphase auch die Chance auf die palliativen Leistungen haben, die heute medizinisch und pflegerisch möglich sind. Genau darum geht es in dem Gesetz. Um nicht mehr, aber auch um nicht weniger.